1. Einleitung: Wenn Hilfe zur Einmischung wird.
Großeltern spielen für viele Familien eine zentrale Rolle. Sie unterstützen im Alltag, geben Sicherheit, übernehmen Verantwortung und sind wichtige Bindungspersonen für die Kinder. Doch was passiert, wenn diese Unterstützung kippt? Wenn Ratschläge zu Kritik, Hilfe zur Kontrolle oder liebevolle Gesten zu übergriffigem Verhalten werden?
In der Familienberatung häufen sich Anfragen von Eltern, die zwischen Dankbarkeit und innerer Anspannung schwanken: Sie wollen die Hilfe der Großeltern nicht missen, fühlen sich aber in ihrer elterlichen Rolle nicht ernst genommen. Besonders in Patchworkfamilien oder nach Trennungen entstehen schnell komplexe Dynamiken.
In diesem Artikel beleuchten wir, wie übergriffiges Verhalten von Großeltern aussehen kann, welche Ursachen dahinterliegen – und wie Eltern einen gesunden Weg zwischen Wertschätzung und Abgrenzung finden können.
2. Wenn Grenzen verschwimmen: Formen übergriffigen Verhaltens
Nicht jede Kritik ist übergriffig. Und nicht jede gut gemeinte Geste problematisch – etwa wenn Großeltern ungefragt neue Kleidung für die Kinder kaufen oder Ratschläge geben, ohne deren Notwendigkeit zu prüfen. Solche Gesten sind meist liebevoll gemeint, können aber unterschwellig Druck ausüben oder als Einmischung wahrgenommen werden. Doch in manchen Familien entwickeln sich Muster, in denen Großeltern regelmäßig Grenzen überschreiten:
ständige Kritik an Erziehung, Kleidung oder Tagesstruktur
eigenmächtige Entscheidungen ohne Absprache (z. B. Süßigkeiten, Fernsehen, Ausflüge)
Abwertung des Partners oder der Partnerin (besonders in Patchworkkontexten)
gezielte Einflussnahme auf Kinder gegenüber den Eltern
Verbreiten von Schuldgefühlen („Wir haben euch doch immer unterstützt“)
Gerade diese subtilen Grenzverletzungen sind schwer greifbar – und doch spürbar. Sie führen zu innerer Anspannung, dem Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen, oder zu schleichendem Vertrauensverlust.

3. Warum es Großeltern schwerfällt, loszulassen
Viele Großeltern erleben das Elternwerden ihrer Kinder als Wendepunkt – eine Beobachtung, die auch in familienpsychologischen Studien bestätigt wird (vgl. z. B. Walper & Andresen, DJI, 2019).: Sie möchten ihr Wissen weitergeben, Bindung aufbauen und Teil des neuen Familienkapitels sein. Gleichzeitig müssen sie lernen, nicht mehr die erste Bezugsperson zu sein – eine Herausforderung, die Verlust- und Kontrollängste auslösen kann.
Hinzu kommen häufig eigene unverarbeitete Themen:
eigene Erziehungsmuster
unaufgelöste Rollenkonflikte
Ängste vor Entfremdung
das Bedürfnis, weiterhin gebraucht zu werden
Ohne bewusste Reflexion führen diese inneren Themen leicht zu übergriffigem Verhalten – oft aus einer Mischung aus Sorge, Überforderung und überzogener Verantwortung.
4. Der Blick der Kinder: Loyalitäten im Spannungsfeld
Kinder nehmen mehr wahr, als Erwachsene oft glauben. Wenn Großeltern elterliche Regeln untergraben oder ein Elternteil offen kritisieren, geraten Kinder in Loyalitätskonflikte. Sie spüren, dass ihre Zuneigung als Druckmittel dient – und entwickeln Schuldgefühle, Verunsicherung oder Unsichtbarkeit.
In Patchworkfamilien verstärkt sich dieses Spannungsfeld oft noch: Wenn ein Großelternteil nur „das eigene“ Enkelkind bevorzugt, oder neue Partner:innen nicht akzeptiert werden, spalten sich Zugehörigkeit und Bindung.
Wichtig ist deshalb: Erwachsene müssen Verantwortung für die Beziehungsgestaltung übernehmen – damit Kinder nicht zum Spielball ungelöster Konflikte werden.
5. „Aber sie helfen uns doch“ – das emotionale Dilemma
Gerade wenn Großeltern sich im Alltag stark engagieren – Babysitting, Fahrdienste, Unterstützung im Haushalt – fällt es besonders schwer, Grenzen zu setzen. Man möchte nicht undankbar erscheinen, Konflikte vermeiden oder die Beziehung gefährden. Doch: Hilfe darf kein Tauschmittel sein. Wer hilft, um Einfluss zu nehmen, kontrolliert. Und wer Hilfe annimmt, darf dennoch eigene Entscheidungen treffen.
Wichtig ist deshalb: Dankbarkeit schließt Abgrenzung nicht aus. So kann etwa eine Mutter die Großeltern regelmäßig um Betreuung bitten, weil beide Elternteile voll berufstätig sind. Dennoch fühlt sie sich zunehmend unwohl, wenn Schwiegereltern ungefragt die Schlafenszeiten oder Essgewohnheiten des Kindes verändern. In einem Gespräch macht sie deutlich, wie dankbar sie für die Unterstützung ist – und zugleich, dass sie sich wünscht, dass Absprachen eingehalten werden. Dieses Beispiel zeigt: Wertschätzung und klare Grenzen schließen sich nicht aus, sondern ermöglichen ein respektvolles Miteinander. Im Gegenteil – ein wertschätzender Umgang auf Augenhöhe braucht klare Linien. Wenn Eltern das Gefühl haben, sich für jede Unterstützung „revanchieren“ zu müssen – etwa mit Erziehungsanpassung oder ständiger Präsenz – entsteht kein Miteinander, sondern ein unausgesprochenes Machtgefälle.
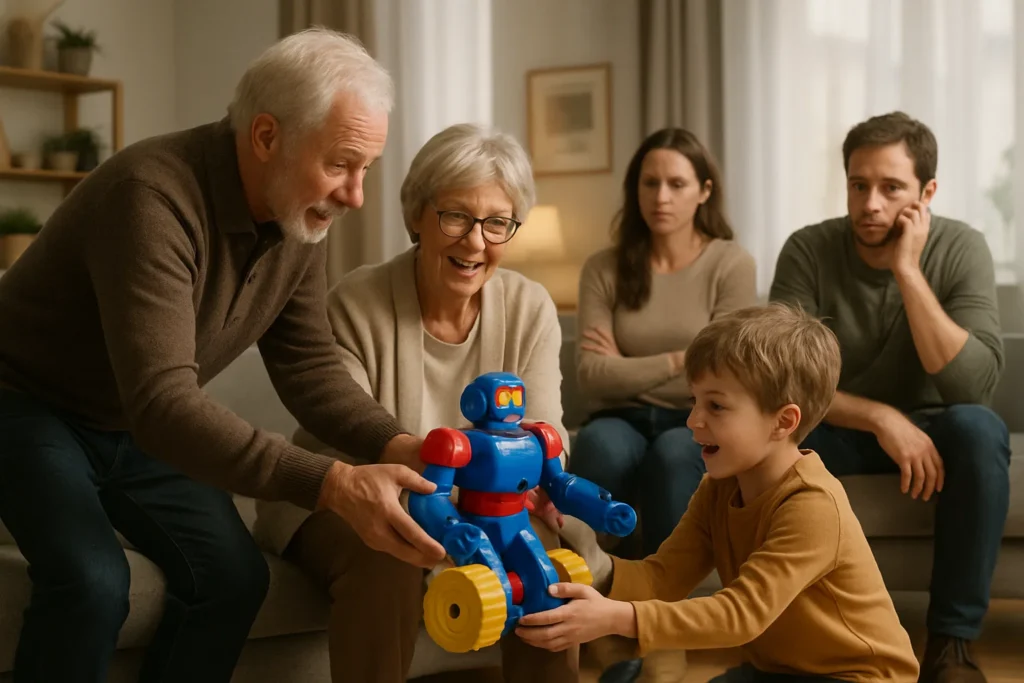
6. Abgrenzung lernen – ohne Kampf, aber mit Klarheit
In der Familienberatung geht es oft darum, innere und äußere Grenzen zu stärken. Viele Konflikte mit Großeltern lassen sich nicht durch mehr Erklären oder Diskutieren lösen, sondern durch konsequentes Verhalten.
Beispiele für klare, aber respektvolle Kommunikation:
„Wir wissen deine Unterstützung sehr zu schätzen – und möchten trotzdem eigene Wege in der Erziehung gehen.“
„Ich merke, dass mich manche Kommentare verunsichern. Ich wünsche mir, dass du meine Entscheidungen akzeptierst.“
„Wir gestalten unsere Feiertage dieses Jahr anders – bitte nimm es nicht persönlich.“
„Wenn du Kritik hast, sprich sie bitte unter vier Augen an – nicht vor den Kindern.“
Wichtig ist dabei der Fokus auf Ich-Botschaften und die Verantwortung für das eigene Empfinden. Wer Vorwürfe vermeidet und Grenzen ruhig, aber bestimmt setzt, signalisiert: Hier ist Raum für Beziehung – aber nicht für Grenzverletzung.
7. Patchwork-Kontexte: Wenn Loyalitäten besonders gefordert sind
In Patchworkfamilien können Konflikte mit Großeltern besonders intensiv erlebt werden. Etwa wenn:
Der neue Partner von einem Großelternteil abgelehnt wird
Kinder aus vorherigen Beziehungen unterschiedliche Behandlungen erfahren
Ex-Partner:innen noch Teil der Familienkontakte sind
Erziehungsstile stark voneinander abweichen
Großeltern, die dem neuen Partner mit Skepsis begegnen oder sich auf „ihr“ Enkelkind fokussieren und andere ausschließen, verstärken oft ungewollt Spannungen im System.
Hier helfen systemische Perspektivwechsel: Wer verstehen möchte, warum Großeltern sich so verhalten, kann fragen: Wovor haben sie vielleicht Angst? Was bedeutet Loyalität für sie? Und wie können alle Beteiligten neue Formen von Zugehörigkeit entwickeln – ohne alte Konflikte zu wiederholen?
8. Familienberatung als geschützter Raum
Manche Spannungen lassen sich im Alltag kaum auflösen, weil sie emotional zu aufgeladen sind oder Gespräche immer wieder in alte Muster zurückfallen. In einer systemischen Familienberatung wird zunächst gemeinsam geschaut, wie alle Beteiligten die Situation erleben. Dann werden mit Hilfe einer neutralen Leitung neue Perspektiven eröffnet, Bedürfnisse formuliert und Kommunikationsmuster analysiert. Häufig kommen dabei Methoden wie das Genogramm, das Aufstellen von Familiensystemen oder der Einsatz von zirkulären Fragen zum Einsatz – immer mit dem Ziel, das Verständnis füreinander zu fördern und tragfähige Lösungen zu entwickeln., weil sie emotional zu aufgeladen sind. Hier kann eine systemische Familienberatung helfen: als neutraler Raum, in dem alle Stimmen gehört und Konflikte neu betrachtet werden können.
Gerade Großeltern profitieren davon, wenn sie sich einbezogen fühlen – nicht als Gegner, sondern als Teil des Familiensystems. Eine professionelle Beratung kann helfen, alte Rollenmuster zu reflektieren, neue Kommunikationsformen zu finden und gemeinsame Werte zu definieren.
Für Eltern bedeutet das: Sie müssen nicht alleine moderieren, vermitteln oder erklären. Familienberatung ist kein Zeichen von Schwäche – sondern Ausdruck von Verantwortung.

9. Nähe neu definieren: Was bedeutet gute Großelternschaft heute?
Viele Großeltern stehen selbst unter Druck: Sie möchten präsent sein, sich einbringen – aber nicht bevormunden. Gleichzeitig erleben sie sich manchmal als „entwertet“, wenn ihre Erfahrungen in Erziehungsfragen nicht mehr zählen oder ihr Lebensstil hinterfragt wird.
Hier braucht es neue Bilder von Großelternschaft: Nicht als allwissende Ratgeber, aber auch nicht als bloße Besucher. Sondern als aktive, aber respektvolle Beziehungspersonen, die die elterliche Führung anerkennen – und so zur emotionalen Sicherheit des Kindes beitragen.
Gute Großelternschaft heute heißt:
Die elterliche Kompetenz stärken, statt infrage zu stellen
Eigene Grenzen und Kräfte anerkennen – und offen kommunizieren
Kinder individuell annehmen – auch in Patchworkkonstellationen
Vertrauen zeigen – in die elterlichen Entscheidungen und in die Entwicklung der Kinder
Das erfordert oft ein Loslassen alter Vorstellungen. Doch genau darin liegt die Chance, sich als Großeltern neu zu finden – und Beziehungen auf Augenhöhe zu gestalten.
10. Fazit: Dankbarkeit darf Grenzen haben
Großeltern können eine wichtige Ressource sein – emotional, praktisch, familiär. Doch ihre Rolle muss wachsen dürfen – nicht auf alten Ansprüchen beruhen. Wenn Eltern das Gefühl haben, sich rechtfertigen zu müssen, sind Beziehung und Erziehung in Schieflage.
Familienberatung hilft dabei, neue Gesprächsformen zu etablieren, Konflikte zu entlasten und gesunde Grenzen zu stärken – damit alle Generationen voneinander profitieren können, ohne sich gegenseitig zu überfordern.
Wertschätzung braucht kein Aufopfern. Und Nähe braucht auch Distanz. Wenn beides gelingt, entsteht das, was sich viele Familien wünschen: ein unterstützendes, liebevolles und respektvolles Miteinander – generationenübergreifend und auf Augenhöhe.
Externe Fachinformationen
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) – Informationsmaterial zu Erziehung, Familie und psychischer Gesundheit: www.bzga.de
Deutsche Liga für das Kind – Familienbildung, Generationenbeziehungen und Großelternrolle:
www.liga-kind.de
Familienhandbuch des Staatsinstituts für Frühpädagogik (IFP) – Fachartikel zu Familienstrukturen und Konfliktdynamiken: www.familienhandbuch.de
Buchempfehlung
Isabelle Filliozat: Was Großeltern heute brauchen (Beltz, 2022)
Remo H. Largo: Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung (Piper, 2017)

Als Single nach Berlin gezogen, dann Eltern geworden – und die Großeltern leben weit verstreut
Einführung Berlin zieht seit Jahrzehnten Menschen aus ganz Deutschland und der Welt an – oft wegen Arbeit, Studium oder der besonderen kulturellen Vielfalt. Wer hier als Single herkommt, baut sich zunächst ein eigenes Netzwerk auf. Wird man später Eltern, ändert sich vieles. Plötzlich merkt man, wie sehr familiäre Unterstützung fehlt,

Zwischen Freiheit und Bindung – Wie Berliner Paare ihre Intimität gestalten können
Berlin ist bunt, lebendig, voller Möglichkeiten – und gleichzeitig ein Ort, an dem Beziehungen oft unter besonderen Bedingungen entstehen und wachsen. Das schnelle Tempo der Stadt, die kulturelle Vielfalt, wechselnde Arbeits- und Lebensrhythmen, hohe Erwartungen an Individualität und Freiheit: All das kann Beziehungen bereichern – oder auf die Probe stellen.

Liebeskummer und Selbstwert – Wege aus der inneren Krise
Einleitung: Wenn das Herz schwer wird Liebeskummer ist eine der intensivsten emotionalen Erfahrungen, die ein Mensch machen kann. Er kann uns den Boden unter den Füßen wegziehen, unser Selbstwertgefühl erschüttern und das Vertrauen in uns selbst infrage stellen. Doch gerade in dieser schwierigen Zeit liegt auch die Chance, den eigenen
